Rechnungshof prüfte Maßnahmen zur Entlastung der Spitalsambulanzen in Kärnten
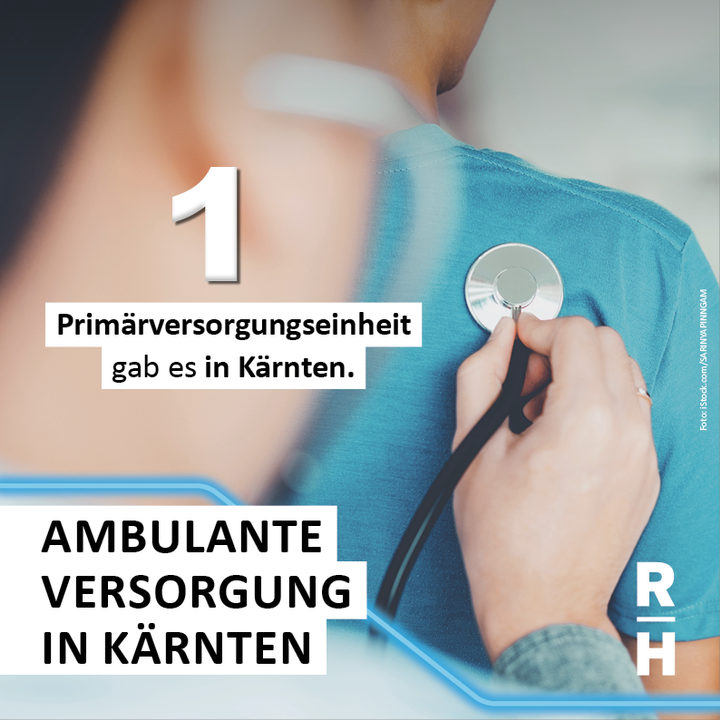
Der Rechnungshof veröffentlichte heute seinen Bericht „Ambulante Versorgung in Kärnten“. Thema war unter anderem die Frage, wie effizient die Maßnahmen zur Entlastung der Spitalsambulanzen sind. Es zeigte sich: Sowohl die telefonische Gesundheitsberatung 1450 als auch Hausärztliche Bereitschaftsdienste wurden in Kärnten vergleichsweise wenig in Anspruch genommen. Gestiegen sind hingegen Kontakte in Spitalsambulanzen aber auch bei Vertragsärztinnen und Vertragsärzten im niedergelassenen Bereich. Und: Einmal mehr weist der Rechnungshof auf die verbesserungswürdige Datenlage hin, etwa bei der Dokumentation von Diagnosen. Der überprüfte Zeitraum umfasst im Wesentlichen die Jahre 2017 bis 2021.
Die Hälfte aller Fälle in Erstversorgungsambulanzen laut KABEG nicht dringlich
Aufgabe von Ambulanzen öffentlicher Krankenanstalten ist die Erstversorgung in Akutfällen. Aber auch die geplante Behandlung und Untersuchung mit Methoden, die außerhalb einer Krankenanstalt nicht verfügbar sind, ist ihr Auftrag. Laut der Kärntner Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft (KABEG) kommen in ihre Erstversorgungs-Ambulanzen viele Patientinnen und Patienten, die zumindest teilweise auch im niedergelassenen Bereich behandelt werden könnten. Mindestens 50 Prozent der in Erstversorgungs-Ambulanzen behandelten Fälle seien laut KABEG nicht dringlich.
Telefonische Gesundheitsberatung 1450 wird in Kärnten weniger gewählt
Die Gesundheitsberatung 1450 zielt auch auf eine Entlastung der Spitalsambulanzen ab. Bis zu 46 Prozent der Anruferinnen und Anrufer in Kärnten wurden in den Jahren 2020 und 2022 an den niedergelassenen Bereich verwiesen. Mangels Evaluierung bleibt allerdings offen, ob die Gesundheitsberatung 1450 tatsächlich eine spitalsentlastende Wirkung entfaltete. Der Rechnungshof weist außerdem auf den starken Rückgang der telefonischen Beratungen in Kärnten hin – diese sanken zwischen 2020 bis 2022 um 59 Prozent – Anrufe wegen COVID-19-Symptomen sind hier bereits ausgenommen. Zum Vergleich: Im Österreichschnitt war die Zahl der telefonischen Beratungen fünfmal so hoch wie in Kärnten. Der Rechnungshof empfiehlt, die geringe Inanspruchnahme der Gesundheitsberatung 1450 in Kärnten zu analysieren und Gegenmaßnahmen zu veranlassen.
Hausärztliche Bereitschaftsdienste weniger in Anspruch genommen
In Kärnten stehen Hausärztliche Bereitschaftsdienste zur Verfügung: Im Wesentlichen montags bis freitags zwischen 19:00 Uhr und 7:00 Uhr, zusätzlich freitags zwischen 13:00 Uhr und 19:00 Uhr sowie am Wochenende und an Feiertagen. Von 2015 bis 2021 wurden diese Dienste – vor allem an Wochentagen – immer weniger genutzt. Die Zahl der Visiten und Ordinationen ging an Werktagen um 74 Prozent zurück. Zugleich blieben 2021 in Kärnten 21 Prozent der Diensteinheiten unter der Woche unbesetzt. An Wochenenden und Feiertagen waren 13 Prozent der Bereitschaftsdienste in Kärnten nicht besetzt. Unbesetzte Diensteinheiten an Wochenenden und Feiertagen deckte zur Zeit der Prüfung durch den Rechnungshof der COVID-Visitendienst ab, der Ende März 2023 auslief.
Der Rechnungshof empfiehlt: Lösungen für eine flächendeckende und effizientere Gestaltung der Hausärztlichen Bereitschaftsdienste wären zu erarbeiten. Dabei wären Synergien mit der Gesundheitsberatung 1450 zu berücksichtigen und die Wirkung auf die Spitalsambulanzen zu erheben beziehungsweise ihre allfällige Entlastung zu prüfen.
Zur Entlastung der Spitäler könnten auch Primärversorgungseinheiten beitragen. Sie zeichnen sich vor allem durch längere Öffnungszeiten und die Einbindung zusätzlicher Gesundheitsberufe aus. Laut dem Regionalen Strukturplan Gesundheit Kärnten 2025 waren fünf Primärversorgungseinheiten vorgesehen. Mitte Mai 2023 gab es in Kärnten nur eine Primärversorgungseinheit in Klagenfurt am Wörthersee.
Datenlage nach wie vor verbesserungswürdig
Einmal mehr weist der Rechnungshof auf die verbesserungswürdige Datenlage im Gesundheitsbereich hin. Nach wie vor ist ein umfassender Vergleich zwischen Leistungen, die in Spitalsambulanzen erbracht werden und jenen im niedergelassenen Bereich nicht möglich. Dies wäre jedoch für eine optimale Planung und Steuerung der Versorgungsstrukturen unverzichtbar.
Die standardisierte Diagnosendokumentation fehlte im niedergelassenen Bereich nach wie vor – Primärversorgungseinheiten ausgenommen. Auch die Krankenanstalten waren bei ambulanten Kontakten nur in speziellen Bereichen verpflichtet, Diagnosen zu dokumentieren. Lob gab es in diesem Zusammenhang für die Kärntner Krankenanstalten, die im gesamten ambulanten Bereich Diagnosen dokumentierten.
Die Empfehlung des Rechnungshofes: Vom Gesundheitsministerium wäre im niedergelassenen Bereich eine verpflichtende standardisierte Diagnosendokumentation vorzusehen. Die Diagnosendokumentation im spitalsambulanten Bereich wäre auf alle Diagnosen auszuweiten. Laut Stellungnahme des Gesundheitsministeriums sei die geplante verpflichtende Diagnosendokumentation schrittweise umzusetzen – entsprechende Bestrebungen zeigen sich auch im aktuellen Gesetzesentwurf zur Gesundheitsreform.
Presseinformation: Ambulante Versorgung in Kärnten
- pdf Datei:
- 3,077.6 KB
- Umfang:
- 94 Seiten
Bericht: Ambulante Versorgung in Kärnten
Der Rechnungshof überprüfte von Juni 2022 bis Jänner 2023 die (spitals-)ambulante Versorgung in Kärnten. Prüfungsziele waren
• die Analyse des ambulanten Abrechnungsmodells (LKF-ambulant) und seiner Weiterentwicklung, insbesondere der Abrechnung bisher tagesklinisch erbrachter Leistungen als Ambulanzleistungen, sowie der Diagnosendokumentation,
• die Analyse des Leistungsangebots sowie der Erfassung und Abrechnung spitalsambulanter Leistungen in ausgewählten Versorgungsbereichen im Klinikum Klagenfurt am Wörthersee und im Landeskrankenhaus Villach und
• die Analyse von Maßnahmen mit potenziell spitalsentlastender Wirkung (insbesondere Primärversorgungseinheiten) in Kärnten.
Der überprüfte Zeitraum umfasste im Wesentlichen die Jahre 2017 bis 2021. Darüber hinaus ging der Rechnungshof auch auf frühere und spätere Entwicklungen ein.


