Tilgungskosten und Tilgungsplan für NextGenerationEU-Mittel unklar
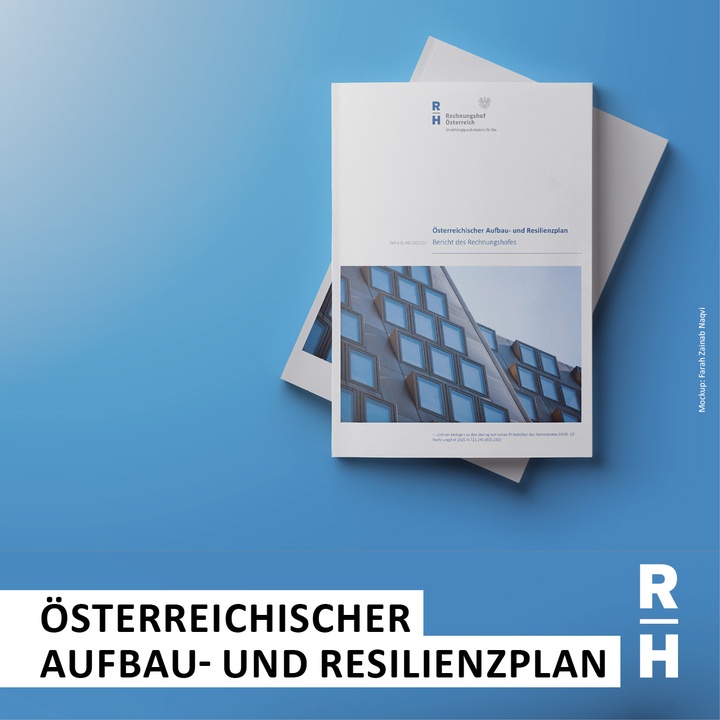
Mit der Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) stellte die EU Österreich 3,961 Milliarden Euro in Form von Zuschüssen für die Umsetzung von Maßnahmen in den Jahren 2020 bis 2026 zur Verfügung. Diese Mittel sind seitens der EU schuldenfinanziert; insgesamt wurden für alle EU-Mitgliedstaaten 750 Milliarden Euro aufgenommen. Im heute veröffentlichten Bericht „Österreichischer Aufbau- und Resilienzplan“ (ÖARP) empfehlen die Prüferinnen und Prüfer des Rechnungshofes, rasch einen verbindlichen Tilgungsplan zu vereinbaren. Geprüft wurde beim Finanzministerium, der zentralen nationalen Koordinierungsstelle, unter anderem die Implementierung des ÖARP, das Monitoring und Abrechnungen mit der Europäischen Kommission. Verbesserungsbedarf gab es bei der Konzeption und Umsetzung des Förderinstruments. Der überprüfte Zeitraum umfasste im Wesentlichen die Jahre 2020 bis Ende Juni 2024.
Schuldenbasierte Aufnahme der EU-Mittel
2020 einigten sich die EU-Mitgliedstaaten aufgrund des COVID-19-bedingten Wirtschaftseinbruchs darauf, den Aufbauplan „NextGenerationEU“ einzurichten. Sie ermächtigten damit die Europäische Kommission, an den Kapitalmärkten bis zu 750 Milliarden Euro aufzunehmen. Davon stellte sie den Mitgliedstaaten 672,5 Milliarden Euro über die sogenannte Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) als Zuschüsse (312,5 Milliarden Euro) beziehungsweise als Darlehen (360 Milliarden Euro) zur Verfügung.
Österreich entschied, die maximal möglichen Zuschüsse in Höhe von 3,961 Milliarden Euro in Anspruch zu nehmen. Auf Darlehen wurde verzichtet.
Schuldentilgung: Verbindliche Daten fehlten
Der Rechnungshof merkt kritisch an, dass mit dem Beschluss der Schuldenaufnahme keine verbindlichen Daten dazu vorlagen, wie hoch die von den EU-Mitgliedstaaten zu tragenden Kosten für die Tilgungen sein werden. Festgelegt war lediglich, dass die Tilgung bis spätestens 31. Dezember 2058 erfolgen sollte.
Aufgrund der mitzutragenden Tilgungskosten für die Schuldenaufnahme der EU könnten die künftigen Zahlungsverpflichtungen Österreichs an die EU deutlich höher ausfallen als die möglichen Zuschüsse. Beispielsweise belief sich eine Schätzung des Finanzministeriums zum Stand 2020 auf potenzielle 12,077 Milliarden Euro (zu den Preisen von 2018) an Tilgungskosten für Österreich.
Der Rechnungshof empfiehlt dem Finanzministerium, auf EU-Ebene darauf hinzuwirken, dass die EU-Mitgliedstaaten im Sinne der Transparenz rasch einen verbindlichen Tilgungsplan vereinbaren.
Meilensteine: Wesentliche Vorgaben erst im Zuge der Umsetzung konkretisiert
Für die Gewährung der Zuschüsse nutzte die Kommission ein neues Modell: Die Zahlung der EU-Mittel wurde an das Erreichen von Meilensteinen geknüpft.
Der Österreichische Aufbau- und Resilienzplan (ÖARP) enthielt 64 Maßnahmen, zu denen insgesamt 178 Meilensteine definiert waren. Maßnahmen waren Investitionen – etwa in den Breitbandausbau – oder Reformen, zum Beispiel das Gesetz zur Einführung eines verpflichtenden Klimachecks für neue Gesetzesvorschläge oder ein Gesetz zur Einführung des automatischen Pensionssplittings. Für den Breitbandausbau galten beispielsweise drei Meilensteine. Mit dem letzten Meilenstein sollten bis zum Ende des dritten Quartals 2026 mindestens 80.000 Haushalte Zugang zu gigabitfähigen Netzen haben.
Die Europäische Kommission konkretisierte wesentliche Vorgaben und Vorgangsweisen erst im Laufe des Umsetzungsprozesses. Sie veröffentlichte beispielsweise erst im Jahr 2023 ein Schema zu den monetären Auswirkungen, sollte ein Meilenstein nicht erreicht werden.
Meilensteine teilweise unzweckmäßig definiert
Die in den ÖARP eingebundenen damaligen neun Ministerien definierten die Meilensteine teilweise unzweckmäßig und erreichten sie zum Teil nicht oder verspätet. Die Folge: Das Finanzministerium konnte Zahlungsanträge nicht plangemäß bei der Kommission einreichen. Dadurch waren eine längere nationale Vorfinanzierung beziehungsweise intensive Abstimmungsprozesse erforderlich.
Nationale Mittel zur Erreichung der Meilensteine
Der Rechnungshof weist darauf hin, dass die geschätzten, insgesamt für die Meilenstein-Erreichung nötigen Mittel (5,915 Milliarden Euro, Stand Juli 2023) deutlich höher sind als die maximal mögliche Finanzierung aus EU-Mitteln (3,961 Milliarden Euro).
Ob die EU-Mittel ausbezahlt werden, ist ausschließlich davon abhängig, ob die definierten Meilensteine erreicht werden, unabhängig davon, wie die Mitgliedstaaten die Umsetzung der Maßnahmen finanzierten. So kann auch der Fall eintreten, dass zusätzlich noch nationale Mittel eingesetzt werden müssen, um bestimmte Meilensteine erreichen zu können.
Das Finanzministerium hatte kein Konzept entwickelt, um die tatsächlich aufgewendeten nationalen Mittel, die zur Erreichung der Meilensteine für die einzelnen Maßnahmen im ÖARP erforderlich waren, umfassend darzustellen.
Die Europäische Kommission hatte bis September 2024 insgesamt 1,192 Milliarden Euro zur Umsetzung des ÖARP an Österreich ausbezahlt. Der Bund investierte bis zum 30. Juni 2024 rund 2,650 Milliarden Euro in die ÖARP-Umsetzung. Laut Website des Bundeskanzleramtes genehmigte die EU-Kommission schließlich im Juli 2025 weitere Zahlungen in der Höhe von 1,6 Milliarden Euro.
Berichterstattung an den Nationalrat
Insgesamt mahnt der Rechnungshof mehr Transparenz ein. So war etwa keine umfassende finanzielle Berichterstattung an den Nationalrat, zum Beispiel über die erforderlichen nationalen Mittel vorgesehen.
Er empfiehlt: Über den inhaltlichen Umsetzungsstand des ÖARP und über den finanziellen Umsetzungsstand wäre direkt und regelmäßig dem Nationalrat zu berichten. Dies insbesondere vor dem Hintergrund möglicher finanzieller Kürzungen der EU-Mittel, wenn Meilensteine nicht erreicht werden.
Hinzu kommt: Obwohl zur Umsetzung des ÖARP in der Folge auch Gesetzesbeschlüsse erforderlich waren, legte die Bundesregierung dem Nationalrat den ÖARP erst gleichzeitig mit dessen Einreichung bei der Kommission am 30. April 2021 vor. Damit waren Transparenz und Spielraum des Nationalrates bei Entscheidungen im Zusammenhang mit dem ÖARP eingeschränkt.
Presseinformation: Österreichischer Aufbau- und Resilienzplan
- pdf Datei:
- 4,361.7 KB
- Umfang:
- 124 Seiten
Bericht: Österreichischer Aufbau- und Resilienzplan
Der Rechnungshof überprüfte von Mai 2024 bis September 2024 die Umsetzung des Österreichischen Aufbau- und Resilienzplans (ÖARP) beim Bundesministerium für Finanzen, bei der Buchhaltungsagentur des Bundes und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft mbH.
Ziele der Gebarungsüberprüfung waren,
• einen Überblick über die Abwicklung und den aktuellen Umsetzungsstand des ÖARP zu geben und
• die Aufgabenwahrnehmung des Bundesministeriums für Finanzen als zentrale nationale Koordinierungsstelle darzustellen und zu beurteilen, insbesondere bei der Implementierung des ÖARP, beim Monitoring der Maßnahmenumsetzung und Zielerreichung, bei den Abrechnungen mit der Europäischen Kommission und bei der Verwaltung der benötigten Mittel für die Umsetzung des ÖARP.
Der überprüfte Zeitraum umfasste im Wesentlichen die Jahre 2020 bis Ende Juni 2024. Soweit erforderlich berücksichtigte der Rechnungshof auch Sachverhalte außerhalb dieses Zeitraums, z.B. den am 30. September 2024 eingereichten Zahlungsantrag.


